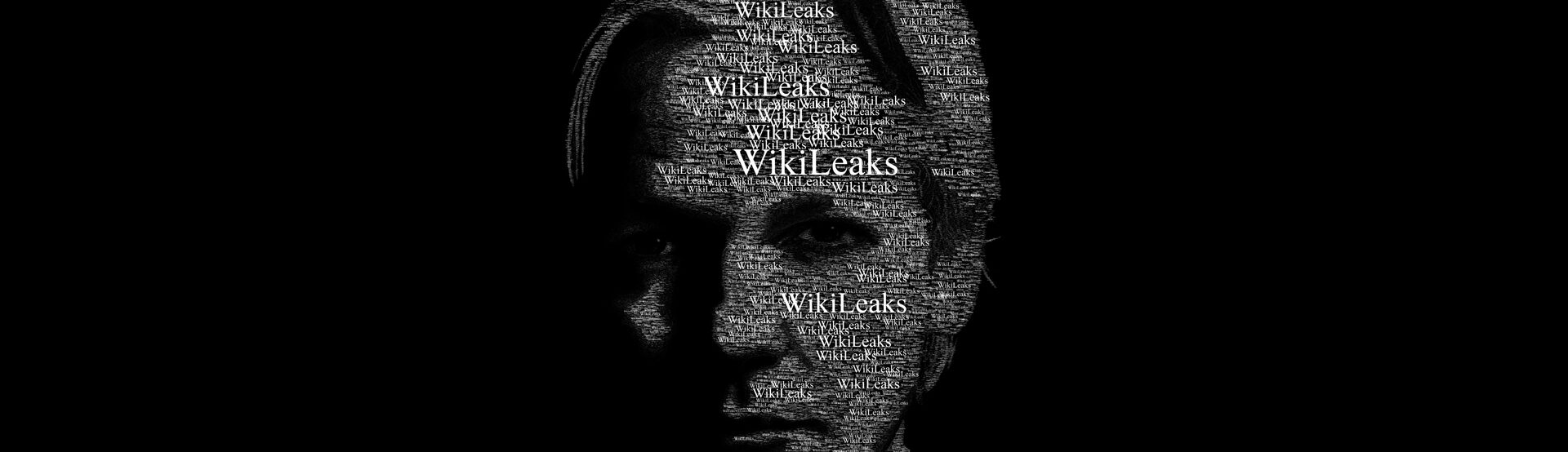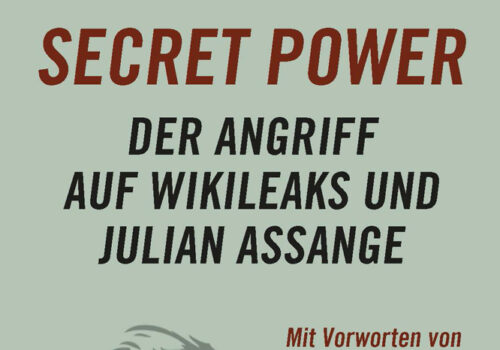Ein neuer Band über den WikiLeaks-Gründer ist im Kölner PapyRossa-Verlag erschienen.
Die große Sünde Assanges bestehe darin, dass er die Wahrheit gesagt habe, so Ken Loach in seinem Vorwort zu einem neuen Buch, das der Geschichte von WikiLeaks nachgeht und damit zugleich eine Außenpolitik der USA dokumentiert, die auf militärischer Stärke und Kriegseinsätzen basiert. Rund fünfzehn Jahre lang recherchierte die italienische Journalistin Stefania Maurizi zu den Hintergründen. Sie arbeitete ab 2009 für ihre jeweiligen Zeitungen mit WikiLeaks und Julian Assange zusammen und ist im internationalen Journalismus die Einzige, die mit den gesamten WikiLeaks-Dokumenten in Berührung kam. Mit dem Buch „Secret Power“ ist so die Geschichte eines mutigen, lange Zeit inhaftierten Journalisten entstanden, der gnadenlos verfolgt wurde, weil er sich getraut hatte, die Verbrechen einer Weltmacht publik zu machen.
Die Autorin beschreibt detailliert die Arbeitsweise und den Kampf von Julian Assange, die eigentlich ein Vorbild für investigativen Journalismus sein sollte. Doch stattdessen musste Assange dafür fünf Jahre und zwei Monate in Haft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, dem „britischen Guantanamo“, absitzen. Seine Zeit im Botschaftsasyl mitgerechnet, kam er erst „nach 14 Jahren willkürlicher Festsetzung“ endlich frei.
Diese Haftanstalt wird von der Autorin mit dem US-Gefängnis Guantánamo Bay verglichen. Zum Vergleich: Während der britische Innenminister Jack Straw von der Labour Party einst die Auslieferung des chilenischen Diktators und Massenmörders Augusto Pinochet aus angeblichen medizinischen Gründen abgelehnt hatte, gab ihm später die Premierministerin Margaret Thatcher freies Geleit. Pinochet verlies London in einem Rollstuhl, aus dem er sich jedoch am Flughafen in Santiago de Chile erhob, aufgestanden wie ein junger Mann. Dagegen wurde Julian Assange durch die britische Polizei, Scotland Yard, am 11. April 2019 aus der Botschaft von Ecuador gezerrt und unter widrigen Bedingungen eingebuchtet. Ihm drohte die Auslieferung an die USA mit dort bis zu 175 Jahren hinter Gittern.
Obamas Vize Joe Biden nannte Assange einen „hi-tech terrorist“. In den USA forderten einige hochrangige Politiker, ihn zu ermorden. Die CIA spielte ernsthaft den Plan durch, Assange „zu entführen oder sogar zu töten“. Auch der Whistleblower Edward Snowden, dessen Enthüllungen im Sommer 2013 einen Einblick in das Ausmaß der weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten der USA, Großbritanniens und Deutschlands gab und der dafür mehrfach von nichtstaatlichen Organisationen ausgezeichnet wurde, wurde gnadenlos verfolgt, öffentliche Aufforderungen zum Lynchmord inklusive. Maurizi resümiert, dass die Pläne, diese Journalisten umbringen zu lassen, „keine hohle Phrase“ gewesen, sondern „todernst gemeint“ waren.
Für Chelsea Manning, Angehörige der US-Armee und Nachrichtendienstanalytikerin, waren die brutalen Verhörmethoden der US-Soldaten mit den irakischen Gefangenen so unerträglich, dass sie beschloss, WikiLeaks Kopien von streng geheimen Videos und Dokumenten der Website zuzuspielen. Die Dokumente, worauf zu der Zeit große Medien weltweit erpicht waren, enthüllten die Einsatzregeln im Irak und in Afghanistan, die Lageranweisungen von Guantanamo, die CIA-Videos von Verhören.
Was die Medien indes kaum nicht registrierten, war das „Afghanistan First“: Vorangegangen waren die Kriege gegen Afghanistan und den Irak und damit die Errichtung vergleichbarer Lager, so auf dem nördlich von Kabul gelegenen Flughafen in Bagram. Die dortigen Haftbedingungen samt den angewandten Verhör– und Foltermethoden hatten Modellcharakter für Guantanamo. Dass die Foltermethoden hier wie dort eindeutig gegen grundlegende Menschenrechte verstießen und international zu scharfer Kritik führten, tangierte die USA nicht. „Wir haben die Wahrheit über Zehntausende von verheimlichten Kriegsopfern und andere ungesehene Schrecken, über Programme zur Ermordung, Überstellung, Folter und Massenüberwachung herausgefunden und veröffentlicht. Wir haben nicht nur aufgedeckt, wann und wo diese Dinge geschehen sind, sondern häufig auch die Politik, die Vereinbarungen und die Strukturen dahinter“, sagte Julian Assange in einer Rede am 1. Oktober 2024 vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg. Im Prinzip hätten sich die USA wie ein Schurkenstaat verhalten, womit sie eigentlich vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gehörten. Für die deutsche Ausgabe des in mehreren Sprachen übersetzen Buches verfasste Maurizi längere Ergänzungen, die den Weg zu Assanges Freilassung nachzeichnen – gewürdigt als Erfolg einer internationalen Solidaritätskampagne.
Das umfangsreiche Werk lässt sich kaum angemessen rezensieren, denn kein Satz darin erscheint überflüssig. Man wäre geneigt, den ganzen Text wiederzugeben. Um das ganze Ausmaß der US-Verbrechen im afghanischen Gefängnis Bagram und im irakischen Gefängnis Abu Ghraib sowie in Guantanamo zu erfahren, empfiehlt es sich als Pflichtlektüre vor allem für alle Freunde und Kritiker eines als „demokratisch“ definierten Staates, dessen Geschichte von Kriegen, Überfällen und Regimechanges durchzogen ist. Für eine zweite Auflage empfiehlt sich allerdings unbedingt ein Namensregister.
Mit Vorworten von Vincent Bevins und Ken Loach, aus dem Englischen übersetzt von Glenn Jäger.
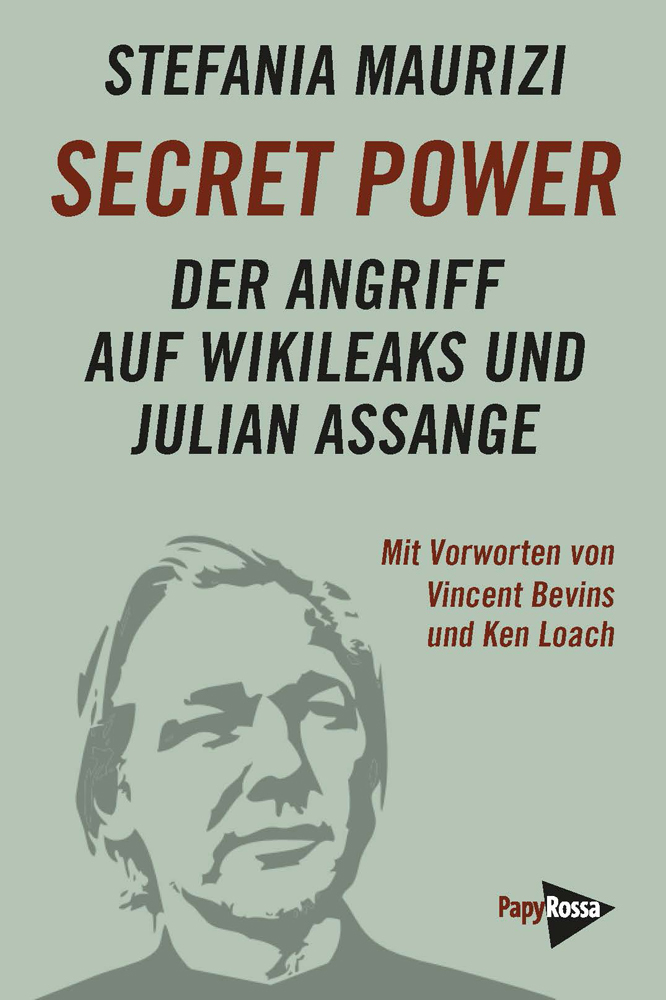
Stefania Maurizi berichtet für die italienische Tageszeitung Il Fatto Quotidiano, zuvor für La Repubblica und l‘Espresso. Ab 2009 arbeitete sie für ihre jeweiligen Zeitungen mit WikiLeaks und Julian Assange zusammen. Im internationalen Journalismus ist sie die Einzige, die an den gesamten WikiLeaks-Dokumenten arbeitete und die einen Rechtsstreit mit mehreren Gerichten führte, um das Recht der Presse auf Zugang zu den vollständigen Dokumenten zu verteidigen.
Besprochen von Matin Baraki.
Eine gekürzte Fassung dieser Rezension erscheint in der März/April-Ausgabe, I/2025, der außenpolitischen Zeitschrift INTERNATIONAL: www.international.or.at.